Lebensberichte 61-2016
Beiträge Mitteilungen > Band 61-2016
Eine Jugend
in Schleswig – Teil 2
von Klaus-Jürgen Laube, herausgegeben von
Marianne Laube
Konfirmandenunterricht
und Jugendkantorei am Dom
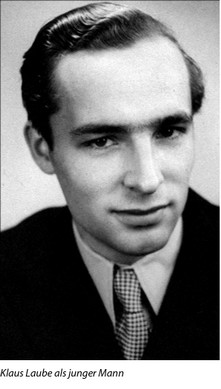 Kaum in Schleswig
sesshaft geworden, wurde ich zum Vorkonfirmandenunterricht, wie es damals hieß,
in der Domgemeinde angemeldet. Pastor Schimmelpfennig erteilte den Unterricht
und hatte große Mühe, sich gegenüber den etwa 100 Konfirmanden/innen durchzusetzen.
Er war zeitweise kaum zu verstehen, zumal er es dabei bewenden ließ, Texte von
Chorälen vorzulesen, unterbrochen von eingeschobenen Erklärungen, die keiner
verstand. Die Choräle mussten dann in der nächsten Stunde auswendig aufgesagt
werden. Wegen der oben erwähnten Erkrankung konnte ich an dem Unterricht schon
bald nach Beginn für etwa drei Monate nicht teilnehmen. Da ich im Krankenhaus
eines Tages die Stimme des Pastors hörte und vermutete, er würde auch zu mir
kommen, war ich zutiefst enttäuscht, als er an meinem Bett grußlos vorbei ging.
Als er nach der ersten Unterrichtsstunde nach meiner Krankheit verlangte,
ich hätte alles nachzuholen und könnte sonst mit dieser Gruppe nicht konfirmiert
werden, überlegten wir zu
Hause, zumindest in der Domgemeinde auf eine Konfirmation zu verzichten. Als
die Landsberger in Schleswig davon hörten und ein „Heimatgottesdienst“ im Dom
bevorstand, trafen sie Vorbereitungen, dass meine Konfirmation in diesem
Gottesdienst stattfinden sollte. Als der früher in Landsberg an der
Marienkirche, unserer Kirchengemeinde, amtierende Pastor Wegener, der diesen
Gottesdienst in Schleswig halten würde, dies erfuhr, hatte er sofort seine
Zustimmung gegeben. Meine Mutter zögerte noch, als ich ihr berichtete, im
Unterricht wäre ein anderer Pastor erschienen, nämlich der pensionierte
Hauptpastor W. W. Meyer, der uns mitteilte, er würde uns in Zukunft
unterrichten. Wir kannten ihn als einen stets freundlich grüßenden „alten
Herrn“ von vielen Begegnungen auf der Straße. Als wir ihm von unserem Problem
erzählten, winkte er nur ab und sagte nur: Lassen Sie ihren Jungen bei uns und
in seiner Gruppe. So geschah es. Pastor Schimmelpfennig war kurz darauf wie vom
Erdboden verschluckt. Ich habe ihn nie wiedergesehen und auch niemals wieder
etwas von ihm gehört.
Kaum in Schleswig
sesshaft geworden, wurde ich zum Vorkonfirmandenunterricht, wie es damals hieß,
in der Domgemeinde angemeldet. Pastor Schimmelpfennig erteilte den Unterricht
und hatte große Mühe, sich gegenüber den etwa 100 Konfirmanden/innen durchzusetzen.
Er war zeitweise kaum zu verstehen, zumal er es dabei bewenden ließ, Texte von
Chorälen vorzulesen, unterbrochen von eingeschobenen Erklärungen, die keiner
verstand. Die Choräle mussten dann in der nächsten Stunde auswendig aufgesagt
werden. Wegen der oben erwähnten Erkrankung konnte ich an dem Unterricht schon
bald nach Beginn für etwa drei Monate nicht teilnehmen. Da ich im Krankenhaus
eines Tages die Stimme des Pastors hörte und vermutete, er würde auch zu mir
kommen, war ich zutiefst enttäuscht, als er an meinem Bett grußlos vorbei ging.
Als er nach der ersten Unterrichtsstunde nach meiner Krankheit verlangte,
ich hätte alles nachzuholen und könnte sonst mit dieser Gruppe nicht konfirmiert
werden, überlegten wir zu
Hause, zumindest in der Domgemeinde auf eine Konfirmation zu verzichten. Als
die Landsberger in Schleswig davon hörten und ein „Heimatgottesdienst“ im Dom
bevorstand, trafen sie Vorbereitungen, dass meine Konfirmation in diesem
Gottesdienst stattfinden sollte. Als der früher in Landsberg an der
Marienkirche, unserer Kirchengemeinde, amtierende Pastor Wegener, der diesen
Gottesdienst in Schleswig halten würde, dies erfuhr, hatte er sofort seine
Zustimmung gegeben. Meine Mutter zögerte noch, als ich ihr berichtete, im
Unterricht wäre ein anderer Pastor erschienen, nämlich der pensionierte
Hauptpastor W. W. Meyer, der uns mitteilte, er würde uns in Zukunft
unterrichten. Wir kannten ihn als einen stets freundlich grüßenden „alten
Herrn“ von vielen Begegnungen auf der Straße. Als wir ihm von unserem Problem
erzählten, winkte er nur ab und sagte nur: Lassen Sie ihren Jungen bei uns und
in seiner Gruppe. So geschah es. Pastor Schimmelpfennig war kurz darauf wie vom
Erdboden verschluckt. Ich habe ihn nie wiedergesehen und auch niemals wieder
etwas von ihm gehört.Nach wenigen Wochen kam es wieder
zu einem Wechsel. Pastor Reinfried Clasen war in eine bisher nur provisorisch
besetzte Pfarrstelle der Domgemeinde gewählt worden. Wir waren seine ersten
Konfirmanden in der neuen Stelle. Als Soldat hatte Pastor Clasen den Krieg und
die Gefangenschaft überlebt und stand noch spürbar unter dem Eindruck seiner
Erlebnisse als Kanonier am Flakgeschütz. Verständlich, wenn er uns in der
ersten Stunde die Berechnung erklärte, die notwendig war, damit die
Kanonenkugel auf ihrer Laufbahn das gewünschte Ziel erreicht und trifft. Das
war spannend und hielt die ganze Gruppe in Atem, sogar die Mädchen. Die
Spannung hielt sich, als danach die eigentlichen Themen zur Sprache kamen, z. B.
Martin Luther und die Reformation, das Abendmahlsverständnis in der
lutherischen, reformierten und katholischen Kirche u. a. Pastor Clasen hatte
einen Sinn für Feierlichkeit und liturgische Praxis, was unserem
Konfirmationsgottesdienst am Sonntag Judika 1949 zugute kam. Mein
Konfirmationsspruch hat mich bis heute wirksam begleitet: „Wer seine Hand an
den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes
(Lukas 9,62).“ Eine besondere Aufmerksamkeit war gegeben, weil auch die Tochter
Annegret des Bischofs D. Wester mit uns konfirmiert wurde. Der Vater ließ es
sich verständlicherweise nicht nehmen, diese Gruppe, zu der seine Tochter
gehörte, einzusegnen.
In der Unterrichtsstunde vor dem
Volkstrauertag/Totensonntag (1948) setzte uns Pastor Clasen davon in Kenntnis,
dass er die Absicht habe, im Fürbittengebet des Gottesdienstes die Namen der
vermissten und gefallenen Väter aufzurufen. Er ging durch die Reihen, fragte
jeden Einzelnen und schloss aus meiner Antwort, der Vater wäre nicht da, dass
dieser vermisst sei. Die Mutter ging, als ich zu Hause davon berichtete,
umgehend zu ihm, um Klarheit zu schaffen, aber auch, um ihm zu erläutern, wie
mich dieser Vorgang und die Sache selbst bedrückten.
Pastor Clasen zeigte großes
Verständnis dafür und hatte dies wohl auch noch im Kopf trotz der großen Zahl
von fast 100 Konfirmanden, als Ende November / Anfang Dezember Frau Barbara
Haller, die Ehefrau des Kirchenmusikdirektors Hans Jakob Haller im Unterricht
erschien. Sie war auf der Suche nach Jungen, die bereit wären, in einem
Knabenchor mitzusingen, der zunächst nur Aufgaben im Rahmen der Liturgie
übernehmen sollte. Die Ausbeute auf ihre Frage an die große Zahl der
Konfirmanden war gering. Pastor Clasen kam ihr zur Hilfe, ermunterte diesen und
jenen und zeigte dann energisch – obwohl ich wie die meisten den Blick leicht
nach unten gesenkt hatte – mit dem Finger auf mich: „Ach, Klaus, und Du gehst
auch dahin!“ Weder er noch Frau Haller noch ich ahnten, dass dieser
„Fingerzeig“ und die diesen begleitende Aufforderung meinen Einstieg in Kirche
und Theologie zur Folge haben würde; denn ich ging. Das ist, wie man heute
sagt, Nachhaltigkeit!
Am Schluss der ersten Probe, wir
waren wohl zehn bis zwölf Jungen, hielt Frau Haller Hermann Brodersen, dessen
Vater die Säule des Tenors im Domchor war, und mich zurück. Sie drückte uns die
Noten der Buxtehude-Kantate „Willkommen süßer Bräutigam“ in die Hand, und wir
mussten Takt für Takt, Zeile für Zeile die Sopranstimme (1. und 2.) singen.
Obwohl ich weder Violin- noch Bassschlüssel, weder c noch cis unterscheiden
konnte, – im Musikunterricht der Mittelschule wurden nur Volks- und
Wanderlieder gebrüllt – schien Frau Haller die Hoffnung zu haben, mit uns
beiden zum Ziel zu kommen. Und tatsächlich! Nach einigen Proben hatten wir
dieses erreicht und konnten die Kantate zwar nicht im Dom, aber doch zu einigen
Advents- und Weihnachtsfeiern in der Domgemeinde zu Gehör bringen.
Daraufhin hat uns Frau Haller
eingeladen, nun auch in die Proben der sich gerade in Gründung befindenden
Jugendkantorei zu kommen. Sonnabends von 16.00 bis 18.00 Uhr probte diese in
der Domhalle. Aber, o weh, wie peinlich, ich war der einzige Junge im Sopran –
Hermann Brodersen war nicht erschienen –, umgeben von vielen jungen, wenn auch
– von mir aus gesehen – älteren Mädchen. Doch ich war auch Mittelpunkt, von
allen beachtet und umsorgt, und das gefiel mir. In der Adventszeit trafen wir
uns morgens um 9.00 Uhr zum Kurrendesingen in der Altstadt. Das gefiel mir
auch, dazu das Singen im Gottesdienst im Dom, also ging ich wieder hin und
blieb. Die Natur bewirkte einen baldigen Wechsel in den „Bass“, und einer von
den Bassisten, der in der Nachbarschaft wohnte (Jürgen Alsen), übte mit mir
Noten, Tonleitern u. ä. Wir trafen uns wöchentlich zu einer Übungsstunde, bis
er sein Studium begann.
Von nun an hatten die Chorproben
und das Singen im Sonntagsgottesdienst einen festen Platz im Wochenplan. Die
Jugendkantorei am Dom – mit mehr als sechzig Jungen und Mädchen –, war schon
bald musikalisch leistungsfähig. Sie sang vierzehntägig im Gottesdienst und gab
Abendmusiken, in denen Motetten alter Meister, vorwiegend von Heinrich Schütz,
aber auch Bachs „Jesu meiner Freude …“ u. a. zur Aufführung kamen. Ihr Ruf
drang über die Grenzen der Stadt hinaus bis in die Region, wie Einladungen nach
Husum, Flensburg, Rendsburg usw. bewiesen. Das war das Verdienst von Frau
Haller, die das musikalischkünstlerische Niveau garantierte, aber den Chor auch
durch ihr stets freundliches, frohes und vor allem warmherziges Wesen zu einer
Gemeinschaft zusammenführte. Sie hatte für jede und jeden ein offenes Ohr, für
die kleinen und manchmal großen Sorgen, immer Zeit und machte keine
Unterschiede, verlangte aber Treue und Zuverlässigkeit. Sie ließ Stippvisiten
nicht zu, was alle wussten.
Frau Haller besuchte uns am
Nachmittag meines Konfirmationstages wie alle Konfirmanden/innen der Kantorei.
Sie schien überrascht über den fröhlichen Kreis von acht Personen, der an einem
„runden Tisch“ zwischen Doppelbett, Liegen, Höckern und Stühlen Platz gefunden
hatte. Es roch nach Kaffee, sogar nach Bohnenkaffee, und der Kuchen wurde
gelobt und gepriesen; denn wir waren nicht verwöhnt!
Hallers wohnten nur wenige
Hausnummern neben uns im Kantorhaus. Frau Haller machte schon am Tag danach den
Vorschlag, dass ich in Zukunft bei ihnen wohnen sollte, wenigstens für die
Zeit, bis ein einigermaßen zumutbarer Wohnraum für vier Personen gefunden
worden ist. Sie merkte wohl, dass dieser Plan bei mir mit spürbarer
Zurückhaltung aufgenommen wurde und reduzierte diesen daher auf ein
wöchentliches Mittagessen (Donnerstag). Dieser Mittagstisch bei Hallers, der
nur selten verlegt oder gar abgesagt wurde, bestand sechs Jahre. Erst als KMD
Haller in eine Stelle am Ulmer Münster gewählt und berufen worden war, fand
dieser Brauch ein Ende. Ich denke gern und dankbar an diese Zeit.
[image:image-1] Die jährlichen Chorfreizeiten der
Kantorei waren Höhepunkte des Jahres. Wir fuhren nach Lübeck, nach Schweden und
nach Undeloh in die Lüneburger Heide. Natürlich konnte ich den Beitrag nicht
bezahlen. Frau Haller hatte längst für einen Zuschuss gesorgt, was sie mich „nur so
nebenbei“ wissen ließ. Ich vermute, dass sie mit Pastor Clasen einen Weg
gefunden hatte. Wir waren jeweils in den Jugendherbergen vor Ort untergebracht.
Vormittags wurde für eine Abendmusik zum Abschluss der Woche geprobt,
nachmittags Ort und Umwelt besichtigt und abends geflirtet, in den Grenzen des
für alle Chormitglieder beiderlei Geschlechts geltenden und auf den 10 Geboten
beruhenden „Grundgesetzes“. Übertretungen sind mir nicht bekannt geworden, auch
dann nicht, wenn wir uns selbst in Versuchung geführt haben mit Madrigalen wie:
„Feinslieb du hast mich gfangen, mit dein zwei Äuglein schön; nach dir steht
mein Verlangen, von dir mag ich nicht geh‘n. Mein Schatz, ich bitt‘ dich eben,
wollst mich auch nicht verlassen (verlahn) – dich allein liebt mein Herze, sag‘
ich ohn allen Scherze, dein Diener will ich sein, bis an das Ende mein“.
Häufiges Verlangen blieb sicher oft ohne Echo und ohne Antwort, hat Herzen
gebrochen und Tränen vergossen, aber so mancher Blickkontakt zwischen Frauen-
und Männerstimmen hat Ehen begründet, die bis heute bestehen, verbunden mit
einer gemeinsamen Erinnerung an die schöne Zeit ihrer Anfänge.
Ich will aber auch von zwei
Erlebnissen erzählen, die mich tief im Inneren berührten und folglich zu dem
Marschgepäck der Erinnerung gehören, die mein Leben begleitet und
möglicherweise auch bestimmt haben. Während der ersten Chorwoche in Lübeck
(1952) haben wir den Dom besucht, dessen „Hoher Chor“ noch in Trümmern lag. Es
ergab sich, dass wir ungeplant und nicht vorbereitet alle darin zusammen
standen und wie von selbst einige Chorsätze sangen. Zum Schluss erklang:
„Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten“. Inzwischen
hatte sich eine stattliche Zahl von Besuchern um uns versammelt, und es war
nach dem letzten Akkord für einige Minuten knisternd still. Mir erschienen die
Bilder der Ruinen Hamburgs aus dem Jahr 1945 und viele andere werden mit
vergleichbaren Gedanken zugehört haben. Alle verließen den Dom schweigend und
auch auf dem Weg zurück in die Jugendherberge wurde kaum gesprochen. Ich kannte
den Psalm 39 noch nicht, der mir erst später im Amt hilfreich geworden ist:
„Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun; denn du hasts getan. Höre
mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien und schweige nicht über meinen
Tränen; …“.
Das andere Erlebnis steht im
Zusammenhang einer Adventsmusik am dritten Adventssonntag im Jahr 1953 (oder
54?). Diese fand nicht wie üblich im Dom, sondern im Hirschsaal von Schloss
Gottorf statt. Der Saal war rundum mit Kerzen erleuchtet und überfüllt. Jüngere
standen noch dicht an dicht an der Wand, nachdem sie Älteren, damals noch
Sitte, ihren Platz angeboten hatten. Wir sangen die bekannten Advents- und
Weihnachtslieder in mehrstimmigen Sätzen. Im Laufe unseres Singens wurde es im
Saal immer stiller und stiller, fast unheimlich still. Wir standen als Chor den
Hörer/innen gegenüber, konnten in die Gesichter sehen, sahen hier und da eine
Träne und hörten verlegenes Husten. Manche der Anwesenden hatten noch Väter,
Söhne und Brüder in russischer Kriegsgefangenschaft; andere ihre Verwandten,
auch Frauen und Töchter im Osten, die nach Sibirien verschleppt waren und viele
wurden noch vermisst. Pastor Clasen sprach das Schlussgebet: „Wenn der Herr die
Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird
unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein … Herr, bringe
wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Mittagslande. Die
mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten (Ps. 126)“. Aus den Tränen war ein
Schluchzen geworden, das im Gebet aufgefangen wurde: „Vaterunser, der du bist
im Himmel“. Nach dem empfangenen Segen gingen die meisten zwar mit verweinten
Augen ihres Weges und doch schien es, als wären sie für diese Stunde dankbar,
getröstet und von zarter Hoffnung erfüllt, dass sie von den weihnachtlichen
Engeln Gottes ebenso begleitet würden wie die Ihrigen in der Ferne. Ich denke
fast jährlich in der Adventszeit an dieses Erlebnis und gern an Frau Barbara
Haller, die mir und uns allen dies in jungen Jahren ermöglicht hat.
Die Jugendkantorei am Dom war in
der Zeit zwischen 1948/49 bis 1956 unter der Leitung Barbara Hallers – über die
Zeit danach habe ich keine Kenntnis – Mitte und Zentrum der ev. Jugendarbeit
mit einer Ausstrahlung über die Gemeindegrenzen hinaus bis in die Stadt. Sie
kamen aus allen Ecken und Enden, um mitzusingen. Hier waren die Stimmen, vor
allem in Bass und Tenor, die sich auch KMD Haller im Domchor wünschte. Also
sangen viele von uns bald in beiden Chören. Der Domchor brachte Bach-Kantaten,
die Passionen Bachs, das Weihnachtsoratorium u. ä. zur Aufführung, meistens von
einem Orchester begleitet, das mühsam für diesen Zweck zusammengestellt war.
Der Nachfolger, KMD Uwe Röhl, hatte dann die finanziellen Mittel zur Verfügung,
eingespielte Orchester zu verpflichten. Die Proben und die Aufführungen unter
Hallers Leitung haben mich mit diesen Werken bekannt und vertraut gemacht. Sie
waren jeweils ein eindrucksvolles Erlebnis und bleiben unvergessen. Aber nicht
nur die Mitwirkung in beiden Chören hat meine musikalische, besonders
kirchenmusikalische Bildung begründet und gefördert, sondern auch die Aufforderung
Hans J. Hallers, ihm an der Orgel zu assistieren. Die Gelegenheit dazu ergab
sich oft, da wir unmittelbar am Dom wohnten. Sonnabends nach der
Wochenschlussandacht, wenn Herr Haller den Sonntagsgottesdienst und die
Orgelvespern vorbereitete, habe ich bei ihm registriert. Ach, da stand ich nun
neben und hinter ihm am Spieltisch und rechts und links davon die Manuale mit
Tafeln voll von Knöpfen und Schaltern. Ein Hoch und Dank dem Pedal, an dem ich
mich im Notenbild mit den vielen schwarzen Balken, schwarzen Punkten und
Köpfen, Strichen und Zahlen einigermaßen orientieren konnte. Sein Nicken
bedeutete „umblättern“, sein Zuruf „drücken“, aber auch deutlich hörbar: Pass
auf, pass doch auf, Schlafmütze, Augen auf, zählen usw. Nach 1½ Stunden stand
er auf, drückte mir die Hand und sprach: „Klaus, ich danke Dir, ich habe schon
lange nicht mehr einen so guten Registranten gehabt wie Dich!“ Das versteht
natürlich nur, wer die Gelegenheit hatte, Herrn Haller kennenzulernen. Wie
heißt es doch so treffend? „Ernst ist das Leben und heiter die Kunst!“
Die Dominanz der Kirchenmusik am
Dom, die Sonne der Gemeindearbeit, warf natürlich auch ihre Schatten. In ihrem
Schatten musste die tüchtige Gemeindehelferin, Frau Maren Jacobsen, versuchen,
ihre Jugendarbeit zur Geltung zu bringen. Das war nicht einfach, führte auch zu
Reibungsverlusten, so dass für mich heute verständlich ist, dass sie einen
Befreiungsschlag versuchte. Frau Jacobsen sammelte aus den Chören um sich einen
kleinen Kreis Jugendlicher, die sie für geeignet hielt, unter ihrer Leitung das
Laienspiel „Ihr werdet sein wie Gott“ von Armand Payot (Uraufführung, Mai 1948
in Genf) einzustudieren und dann auch aufzuführen. Da ich schon Erfahrungen in
der Laienspielgruppe unter der Leitung von H. W. Jürgensen gemacht hatte,
gehörte ich dazu (als Adam), zusammen mit Bärbel Pax (Eva), Gerhard Obst
(Kain), der „Andere Kain“, als sein besseres „Ich“ (Egbert Kahlke), Abel (Frank
Zacharias), Satan (Klaus Jepsen, später Schiller Theater Berlin) und „Die
Stimme“, Pastor Grabow (später Propst am Dom), Frau Jacobsen u. a. Nach knapp
neun Monaten Probezeit waren wir eine „tolle Truppe“, das Stück geburts- und
aufführungsreif, das wir dann in Schleswig (Gaststätte Großer Baumhof) und in
verschiedenen Orten des Umlands gespielt haben.
Dieses Laienspiel bringt die
Sündenfallgeschichte (I. Mose 3) in fünf Akten auf die Bühne. Zwar heißt dieses
Stück: Ein „Laienspiel“, aber wir haben kein leichtes Spiel gehabt, nicht mit
dem Text, nicht mit der Darstellung und schon gar nicht mit dem Inhalt, in dem
es um Sünde und Vergebung, um Gerechtigkeit und Gnade vor Gott und den Menschen
geht. Payot wagt eine individuell geprägte Personalisierung der Sünde, die
verbietet, den heute so negativ besetzten Begriff der Erbsünde leichtfertig vom
Tisch zu wischen.
Wir wohnten in den ersten
Schleswiger Jahren fast Tür an Tür im Schatten des Doms. Ohne diese
Nachbarschaft überschätzen zu wollen, habe ich doch den Eindruck, dass dies
nicht ohne Wirkung auf mich geblieben ist. Aber ich habe den Dom nicht nur von außen,
sondern intensiv von innen erlebt, im Gottesdienst, mit den Chören, als
Kindergottesdiensthelfer und als Domführer, wenn der Küster Karl Reincke
zeitlich unabkömmlich war. Natürlich steht der Bordesholmer bzw.
Brüggemann-Altar, das wird heute nicht anders sein, im Mittelpunkt jeder
Führung. Für mich ist dieser der Altar aller Altäre, die ich kenne, der seit
Jahrzehnten als Poster eingerahmt in meinem Arbeitszimmer hängt. Adam und Eva
stehen in Übergröße oben im Gesprenge auf der Höhe mit der Himmelfahrt und dem
Pfingstwunder, darüber Petrus und Paulus.
Oberhalb des Schreins knien fürbittend Johannes und Maria vor dem
Weltenrichter. Diese Zuordnung gibt manche Rätsel auf, doch klar ist im
Unterschied dazu der Ablauf der Passionsgeschichte bis zum Kreuz dargestellt
und darüber hinaus die Kreuzabnahme und Erscheinung vor den Jüngern. Adam und
Eva dominieren auffällig, bilden mit dem Weltenrichter jedoch ein Dreieck und
damit ein Ganzes, das auf das Weltgericht hinweist, vor dem nur Gebet und
Fürbitte bestehen kann und dies auf dem Hintergrund der Passion.
In der Domschule: 1952-1956
Wir saßen am
Mittagstisch im Musik- und Esszimmer, KMD Hans Jakob Haller, seine Ehefrau
Barbara und ich. Ein großes Fenster gab den Blick frei in die Süderdomstraße,
ein anderes in Richtung Norden gegenüber der Südfront des Domes. Zwischen Tisch
und Fenster stand der große Bechsteinflügel. Wie so oft fragte Herr Haller nach
Geschichtszahlen. Sein Vater, der große Historiker Johannes Haller, hatte
spürbar seine Spuren hinterlassen; denn Herr Haller kannte sich aus in den
Fakten und im Gebüsch der Geschichte. Dank des vortrefflichen
Geschichtsunterrichts in der Mittelschule bei „Opa” Giese konnte ich oft
antworten, was ihn immer wieder erstaunte. Er fragte hartnäckig weiter, bis ihm
Frau Barbara in die Parade fuhr: „Nun lass doch den Jungen endlich in Ruhe
essen!”
Einmal fragte er plötzlich:
„Klaus, was willst du eigentlich werden?” Ich war zu der Zeit in der letzten
Klasse der Mittelschule. Meine Antwort: „Wahrscheinlich werde ich mich bei der
Stadtverwaltung, einer Bank, der Bahn oder bei der Post bewerben.“ Darauf Frau
Haller: Unser Klaus am Postschalter? Kommt überhaupt nicht in Frage, dann schon
lieber eine Ausbildung zum Diakon. Jetzt fuhr er dazwischen: „Aber Bärbel, das
schon gar nicht!“ Nun beide zusammen: „Sag mal, was willst du wirklich?“ Mehr
stotternd als redend gab ich zur Antwort: „Am liebsten würde ich Lehrer werden,
aber dazu braucht man das Abitur.“ Lange, längeres Schweigen, bis eine(r) von
beiden sagte: „Dann musst du eben Abitur machen,“ und ich zur Antwort gab: „Das
geht nicht, wir haben kein Geld, und selbst, wenn ich es versuchen würde, ohne
Nachhilfestunden, die auch noch bezahlt werden müssten, geht das nicht.“
Aber da hatte ich, wie der
Volksmund sagt, die Rechnung ohne den Wirt, in diesem Fall ohne Hallers,
gemacht. Herr Haller erkundigte sich nach den Möglichkeiten bei
Oberstudiendirektor Heinrich Theune, Direktor des Gymnasiums und Frau Haller
bei der Rektorin der Mittelschule, Frau Margarete Schäffler. Ich erfuhr davon
zunächst nichts, bis ich ins Büro der Rektorin gerufen wurde. Sie eröffnete
mir, gehört zu haben, dass ich gern das Abitur machen wollte. Sie hätte
Rücksprache mit dem Direktor der Domschule gehalten, der mich zu einem Gespräch
erwarten würde. Auf dem Weg zu ihm wurde mir Angst und Bange, aber er empfing
mich freundlich zu diesem vorher vereinbarten Termin. Direktor Theune erklärte
mir ausführlich, was ich zu erwarten hätte und vergaß auch nicht darauf
hinzuweisen, dass schon einige wenige diesen Weg versucht, aber wieder
aufgegeben hätten. Schmunzelnd fragte er mich zum Schluss: „Willst du dies
unter diesen Umständen versuchen?“ Als ich ihm antwortete: „Ja, ich will es
versuchen,“ antwortete er mir: „Dann versuchen wir‘s!“
Meine Mutter, der ich stets
berichtet hatte, begleitete dies alles in der Hoffnung, daraus wird doch
nichts. Das war angesichts unserer Situation verständlich und realistisch. Sie
war, als ich mit dem Ergebnis des Gesprächs vom Direktor nach Hause kam,
erschüttert, ja fast verzweifelt. Wie soll das nur werden? Aber da stand schon
Frau Haller in der Tür, um ihre Hilfe anzubieten, die sie bereits mit konkreten
Planungen vorbereitet hatte. Dazu gehörte wöchentlich ein regelmäßiger
Mittagstisch in verschiedenen Familien der Domgemeinde. Wie bisher bei Hallers,
war ich nun auch bei Familie Riecken. P. Ploigt, Dr. Pohl und Bischof
Dr. Wester zu
Gast. Zwar hieß es bei allen, man würde stets so essen wie „üblich“, doch ich
hatte den Eindruck, das Essen war oft etwas üblicher als üblich, wenn ich dabei
war. Die Jugend am Tisch ließ hin und wieder mit der Bemerkung – der Klaus
könnte auch öfter kommen – durchblicken, dass mein Verdacht begründet war. Die
Frauen des Hauses haben mich so unauffällig wie möglich verwöhnt, und ich denke
gern und sehr dankbar an diese Mahlzeiten zurück, die von anregenden und
munteren Tischgesprächen begleitet waren. Nach dem Essen führte mein Weg dann
zunächst in das Haus von Chefarzt Dr. med. Wenzel (Stadtkrankenhaus), wo
täglich für zwei Stunden die Schularbeiten von drei Kindern (Unterstufe im
Gymnasium) zu beaufsichtigen waren. Dafür gab es am Wochenende 20,00 DM, die in
die Haushaltskasse geflossen sind, gelegentlich ergänzt durch ein Suppenhuhn,
Rinderbraten, Rouladen u. ä. Köstlichkeiten, die wir uns nur selten leisten
konnten.
Frau Haller hatte aber auch für
den Nachhilfeunterricht in Latein gesorgt. Die Klasse, in die ich aufgenommen
worden war (Untersekunda), hatte schon drei Jahre Latein, ich aber keinen
Schimmer, musste also, der Grammatik folgend, mit „amare“, der Konjugation
„amo, amas, amat …“ beginnen. Als Lehrer hatten sich auf Anfrage Frau Hallers
Studenten aus der Jugendkantorei bereit gefunden, mich zu unterrichten: cand.
theol. Klaus Detlef Pohl, stud. theol. Helmut Jegodzinski und stud. theol.
Harald Brix. Es blieb nicht nur bei Latein, sondern der Blick fiel auch – wenn
nötig – auf andere Fächer. Sie haben für mich ihre Zeit geopfert und keinen
Pfennig genommen. Ich glaube mit der Behauptung nicht zu übertreiben: Das war
einmalig! Meinen Dank trage ich in meinem Innern und habe ihn vielleicht
erwidert, indem ich meinen Beitrag geleistet habe, dass die Mühen nicht umsonst
gewesen sind. An der Schwelle von der Unter- zur Oberprima war ich über den
Berg.
Wir waren in der
Untersekunda ca. 35 Schüler, von denen fast die Hälfte nach dem Ende des
Schuljahres mit der sog. „Mittleren Reife“ die Schule verlassen wollte. Sie
waren am Unterricht kaum noch interessiert, aber für jede Störung und jeden
Streich zu haben. Ich hatte Mühe, mich irgendwie einzufädeln. Es brauchte seine
Zeit, um sich in die Klasse integriert zu fühlen. Im Laufe des Jahres fanden
diejenigen mehr und mehr zusammen, die das Abitur im Auge hatten. Unter ihnen
war der Klassenkamerad Gerhard Obst, der mir seine Hilfe anbot, sollte es für
mich Probleme geben, welcher Art auch immer. Aus diesem Angebot entstand eine
Freundschaft, die über die Schulzeit hinaus bis ins Studium reichte, zumal wir
beide Theologie studiert haben. Gerd Obst ist hoch musikalisch, hatte
regelmäßig Geigenunterricht, spielte im Schulorchester und kam jetzt auch in
die Jugendkantorei, in der er in kurzer Zeit zu den „führenden“ Tenören
gehörte.
 Als Klassenlehrer hatten wir in der Untersekunda Wilhelm Hansen –
unverheiratet –, der nur „Pinsel Hansen“ genannt wurde. Er unterrichtete
Französisch und Erdkunde. Die Entstehung seines Spitznamens, der im Wortschatz
der Schüler seit Jahren verankert war, ist trotz mehrerer Nachforschungen
damals nicht aufgedeckt worden. Pinsel Hansen war stets freundlich, sein
Unterricht zwar lehrreich, aber ermüdend, also langweilig. Er hatte zur
Vorbereitung unserer Klassenfahrt nach Rantum (Sylt) drei bis vier Schüler zu
sich nach Hause bestellt, die hier in seinem Arbeitszimmer zwar Platz nehmen
sollten, aber keinen Platz fanden. Schreibtisch, Stühle und z. T. der Fußboden
waren mit aufgeschlagenen Büchern, Zeitungsausschnitten, Fotos, von Zetteln mit
Notizen übersät, die an die Seite geräumt werden mussten. Dazwischen war
Geschirr abgestellt, aber nicht abgewaschen und noch von Resten verunreinigt.
Pinsel Hansen, ein liebenswerter Chaot!
Als Klassenlehrer hatten wir in der Untersekunda Wilhelm Hansen –
unverheiratet –, der nur „Pinsel Hansen“ genannt wurde. Er unterrichtete
Französisch und Erdkunde. Die Entstehung seines Spitznamens, der im Wortschatz
der Schüler seit Jahren verankert war, ist trotz mehrerer Nachforschungen
damals nicht aufgedeckt worden. Pinsel Hansen war stets freundlich, sein
Unterricht zwar lehrreich, aber ermüdend, also langweilig. Er hatte zur
Vorbereitung unserer Klassenfahrt nach Rantum (Sylt) drei bis vier Schüler zu
sich nach Hause bestellt, die hier in seinem Arbeitszimmer zwar Platz nehmen
sollten, aber keinen Platz fanden. Schreibtisch, Stühle und z. T. der Fußboden
waren mit aufgeschlagenen Büchern, Zeitungsausschnitten, Fotos, von Zetteln mit
Notizen übersät, die an die Seite geräumt werden mussten. Dazwischen war
Geschirr abgestellt, aber nicht abgewaschen und noch von Resten verunreinigt.
Pinsel Hansen, ein liebenswerter Chaot!„Deutsch“ hatten wir bei Dr.
Neufeld! In seinen Stunden ging es munter und lustig zu. In regelmäßigen
Abständen erfüllten Lachsalven das Klassenzimmer; denn seine Umgangssprache
gehörte in Wortschatz, Ton und Rhetorik in den Kindergarten, aber nicht in eine
Untersekunda. „Stoldt, nun erzähl Du mal was vom Schimmelreiter“. Nach kurzer
Zeit: „Und nun, Laube, erzähl Du mal, was der Stoldt übrig gelassen hat“. So
oder ähnlich war‘s. Natürlich wurde er provoziert, reagierte mit einem
knallroten Kopf, weniger aus Zorn, sondern aus Verlegenheit, weil er meistens
gar nicht verstand, aus welchen Gründen gelacht wurde. Es war nicht nur lustig,
sondern auch peinlich!
Am Ende des Schuljahres, wenige
Tage vor der Zeugniskonferenz, wurde ich auf dem Flur von Direktor Theune mit
der Frage konfrontiert: „Na, Laube, wie geht‘s bis jetzt?“ Da drei „fünfen“ zu
erwarten waren, nämlich in Latein, Englisch und Französisch, also in den
Sprachen, in denen mir die Klasse jeweils um Jahre voraus war, antwortete ich
ihm sinngemäß: „Gemischt“ und bekam die Antwort: „Alle drei fünfen sind besser
als am Anfang des Jahres; und der Pfeil zeigt nach oben!“ Er wusste, dass eine
Wiederholung für mich nicht in Frage kommen konnte und fuhr fort: „Laube, Du
kommst aus Preußen. Die Preußen geben nicht auf!“ Meine Antwort: „Ich gebe auch
nicht auf, solange ich die Chance bekomme, die vorhandenen Lücken zu
schließen.“ Verschiedene Fächer waren mit „2“ bewertet, so dass meine besondere
Situation deutlich wurde.
Jahrzehnte später hat mir ein
Teilnehmer der Zeugniskonferenz berichtet, dass über den Fall „Laube“
ausführlich und kontrovers diskutiert worden war. Zum Schluss habe der Direktor
durchblicken lassen, er habe den Eindruck, dass der Untersekundaner Laube den
festen Willen zeige, sein Ziel, das Abitur, zu erreichen. Die Mehrheit sei wohl
mit ihm der Auffassung, ihm diese Möglichkeit offen zu halten. Die Abstimmung
hätte eine überwiegende Zustimmung zur Versetzung in die Obersekunda ergeben,
ohne Gegenstimme mit zwei oder drei Enthaltungen. Ich ahnte immer und weiß nun,
dass der Wille und die Autorität des Direktors sowie seine geschickte
Verhandlungsführung dieses Ergebnis bewirkt haben und mir damit den Weg zum
Abitur, ins Studium und in meinen Beruf eröffneten.
An die Jahre in der Oberstufe
denke ich gern zurück, trotz der Mühen und mancher Niederlagen, die ich
verarbeiten musste. Zu den Problemen in den Sprachen kamen gelegentlich auch
noch solche in der Mathematik, denn drei Jahre dieses Faches in der Mittelschule
und fünf im Gymnasium, die die Klasse hinter sich hatte, sind auch zweierlei
und nicht ohne weiteres „kompatibel“. In der Unter- und Oberprima hatten wir
Lateinunterricht beim Direktor. Da ich außerdem noch an der Arbeitsgemeinschaft
Latein teilnahm und zwei Mal monatlich lateinische Abende über mindestens zwei
Stunden mit dem Altphilologen Gert Schubert – Teilnehmer im Domchor und später
Schulrat in Berlin – verbrachte, war ich nun in dieser Sprache auf dem
Laufenden. Mir machte Latein jetzt richtig Spaß! Direktor Theune begann in
einer Stunde der Woche den Unterricht, in dem er mit uns über zeitgenössische
Fragen aus Politik und Kultur sprach. Er muss meine Zurückhaltung und
Unsicherheit bemerkt haben; denn da ich mich kaum zu Wort gemeldet habe, erging
an mich fast immer die direkte Frage: „Na, Laube, was denkt man darüber in
christlichen und kirchlichen Kreisen, oder noch besser, was denken oder sagen
Sie dazu?“ Mir ist im Rückblick klar, dass er mir helfen wollte, mein
mangelndes Selbstbewusstsein zu überwinden.
Dieses wurde auch in Frage
gestellt, als ich eines Tages eine Vorladung von dem Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg erhielt, weil eine Anzeige gegen mich wegen
unberechtigten Empfangs von Kindergeld (20,00 DM monatlich) eingegangen war.
Diese Anzeige hatten die Frau meines Vaters und er selbst erstattet. Vermutlich
meinten sie, ich hätte eine Lehre abgeschlossen. Ich bat unseren Klassenlehrer,
Herrn Studienrat Dr. Schacht, der sich entsetzt zeigte, um die dafür notwendige
Befreiung vom Unterricht. Er schüttelte nur mit dem Kopf und sagte mir, das
müsse der Direktor entscheiden. Dieser entschied, dass ich keinen Urlaub
bekäme, denn er selbst würde die Bearbeitung dieses Vorgangs übernehmen. Der
Fall sei damit für mich erledigt und weder meine Mutter, die er herzlich grüßen
ließ, noch ich müssten sich darüber irgendwelche Sorgen machen. Wir haben von
der Sache nichts mehr gehört.
Ganz besonders eindrucksvoll war
der Deutschunterricht bei unserem Klassenlehrer. Seine Interpretation
„klassischer“ Texte hielt die Klasse – jetzt nur noch vierzehn – in Atem. Er
lebte in den Texten, die er uns mit inniger Leidenschaft zu vermitteln
versuchte. Wir haben z. B. „Don Carlos“, „Maria Stuart“, „Iphigenie“ und
zuletzt vor allem den „Faust“ nicht nur vom Stoff her kennengelernt, sondern
sind auch dem Inhalt und den Aussagen begegnet, was in Erinnerung bleibt, auch
wenn Einzelheiten längst verloren sind.
Die Klassenfahrt im letzten Jahr
führte uns in die Berge; denn unser Klassenlehrer liebte die Berge. Ein
Sonderzug für die Oberstufen des nördlichen Schleswig-Holsteins fuhr abends ab
Neumünster in Richtung München. Nach einem flüchtigen Aufenthalt in der Stadt
war unser erstes Ziel Oberaudorf, wo wir in einem, nur in einem Raum alle
übernachtet haben und zwar in zweistöckigen Betten, dicht an dicht. Das konnte
nicht gut gehen, so dass unser Reiseleiter, Dr. Schacht, um Mitternacht in der
Tür stand und Ruhe befahl. Er hatte einen plausiblen Grund; denn für den
nächsten Tag war Bergsteigen angesagt. Es ging auf den Brünnstein, und zwar
langsam, Schritt für Schritt bei schönstem Sonnenschein. Da auch Frau Schacht
mit von der Partie war, hatte das Ehepaar, bergerfahren, untereinander
ausgemacht: Sie geht voran, er macht den Schluss. Damals trugen die Frauen
keine Hosen, sondern Röcke, so auch Frau Schacht. Beim letzten ziemlich steilen
Anstieg vor dem Gipfel ging also Frau Schacht voraus, ihr folgte Günter
Hermann, dann ich und hinter mir Hans-Dieter Roos usw. Oben auf dem Gipfel
angekommen, kam Günter Hermann an meine Seite und flüsterte mir zu: „Du, Klaus,
mir sind eben beim Blick nach oben alle Illusionen vergangen“. Wir
Flachlandtiroler waren überwältigt von der Aussicht auf dem Gipfel, ja
überhaupt von dem Eindruck, den die Berge, Land und Landschaft unter Sonne und
klarblauem, wolkenfreien Himmel auf uns machten. Die Rückfahrt abends von
München begann singend und lachend, auch albern und übermütig, zumal auch
Mädchenklassen im Wagen und in den Abteilen waren. Jetzt hieß es gockeln,
bewusst und meistens unbewusst. Mit der einbrechenden Dunkelheit breitete sich
allmählich Stille aus, man hörte verborgenes Kleiderrauschen durch Platzwechsel
und hätte am Morgen bei Licht besehen vermuten können, im Zug wäre die Neuzeit
angebrochen, die Zeit gemischter Klassen, die Zeit der „coeducation!“ Die
auffällige Bodenlage eines Klassenkameraden mit einem Mädchen im Arm und Schoß
öffnete jeder Art von Phantasie Tor und Tür.
Damit sind wir doch noch im
„Englisch“ angekommen, der Sprache, die damals nicht annähernd die Popularität
und gesellschaftlich-öffentliche Akzeptanz hatte wie heute. Dr. Timm war unser
in der Schule und auch von uns hochgeschätzter Englischlehrer. Er ist uns allen
stets freundlich und verbindlich begegnet und hielt dennoch auf Distanz, war
nicht kumpelhaft und doch jedem zugewandt. So aufrecht wie seine Gestalt, so
aufrecht und integer war sein Wesen. Er war Soldat im Kriege, wie er sich
ausdrückte und litt darunter, dass die deutsche Wehrmacht in dem Ruf stand, an
Kriegsverbrechen schuldig zu sein und Grausamkeiten auch an der
Zivilbevölkerung begangen zu haben. Er habe dies in seiner Einheit und mit
seiner Einheit nie erlebt. Wir glaubten ihm.
Dr. Timm betrat die Klasse stets
mit dem Rest einer schon verglühenden Zigarre, die er auf die untere Leiste der
Tafel ablegte, oberhalb von Schwamm und Kreide. Es ist zwar nicht schriftlich,
aber in der Erinnerung belegt, dass er am Schluss der Stunde und nach der Eintragung
ins Klassenbuch aufstand, den Zigarrenstummel zur Hand nahm, dies niemals
vergessen hat und erst dann den Klassenraum verließ. Zu diesem Ritual gehörte
ein anderes, das mich betraf. Nachdem am Anfang der Stunde der Zigarrenrest auf
seinem Platz lag, drehte er sich um, trat an den Tisch, sah mich an und sagte:
„Na, Laube!“ Die ersten zehn bis fünfzehn Minuten gehörten mir mit Übersetzung
und Paraphrase des Textes. Die Klasse wie auch ich wussten, das war keine
Schikane, sondern Fürsorge. Mein „englisch“ war germanistisch eingefärbt, und
er seufzte oft: Ach, das ist grammatisch alles richtig und doch kein Englisch.
Im Abitur führte er mich durch die mündliche Prüfung in seiner Weise, so dass
er kurz danach auf dem Flur zu mir sagte: „Laube, ich wusste selbst gar nicht,
wie gut Sie in meinem Fach sind”. Dies war eher sein als mein Verdienst. Er war
mindestens ebenso glücklich über den Verlauf der Prüfung wie ich. In der
Abiturabschlussfeier habe ich ihm am Ende einer kurzen Rede mit dem Satz
gedankt: „Die letzten Jahre ohne Sie, what must that for a feeling be!“ Ich sah
von weitem, dass er sich vor Lachen kaum halten konnte.
Als ich nach Jahrzehnten in
Schleswig war, habe ich ihn, nun schon länger im Amt, besucht. Er konnte wegen
eines Rückenleidens zwar gehen und liegen, aber nicht sitzen und litt ständig
unter Schmerzen. Aus einer beabsichtigten Viertelstunde wurde mehr als eine
Stunde, weil er alles wissen wollte, was Beruf und Familie betrifft. Wir
wussten beide, dass wir uns nicht wiedersehen würden. Der Abschied fiel uns
schwer nach einem bewegenden, denkwürdigen Gespräch. Ich werde dieses, ihn
selbst, seinen Unterricht und das Abitur in dankbarer Erinnerung bewahren.
Parallel zur Schulzeit verläuft
aber auch noch eine andere Zeit. Das ist die Zeit, in der das sog. „andere
Geschlecht“ ins Blickfeld tritt. Das erste Datum bleibt verborgen, das die noch
heimlichen Blicke blicken lässt, mal zu dieser, mal zu jener, bis ein Blick
zurück blickt und dieser Rückblick zu einem hoffnungsvollen Ausblick wird. In
Schleswig bot der Stadtweg in den fünfziger Jahren das Blickfeld für den
Laufsteg, auf dem die Schüler der Domschule und die Schülerinnen der
Lornsenschule sich am Wochenende nach Schulschluss im Austausch von Blicken
ergingen. Sie gingen von West nach Ost und von Ost nach West, von der Ecke
Domziegelhof zum Kornmarkt und wieder zurück. Sie gingen besonders motiviert
und angestrengt, wenn ein Klassenball bevorstand; denn: „Tanzen macht nur dann
Vergnügen, wenn wir eine Dame kriegen …“ (W. Busch). Ich kriegte meine Damen
vorwiegend aus der Jugendkantorei, und hier fiel in diesen Primanerjahren meine
Wahl auf Ilse Graubmann, Ulla Kühlmann, Gisela Ludwig, Helga Rosenhagen und
Bärbel Pax.
Die Klassenbälle wurden in der
Regel im Prinzenpalais, im Waldschlösschen und in der Schleihalle gefeiert. Die
ersten beiden stehen noch an ihrem Platz. Die Schleihalle, ausgestattet mit
Tischen und Stühlen an großen Fenstern und mit einer wunderschönen Aussicht auf
den Dom, die Schlei und die Möweninsel, wurde auf Beschluss gedankenloser
Aktivisten gegen den Willen vieler Bürger/innen vor vielen Jahren abgerissen.
Die Klassenbälle gehören zu den
schönsten Erinnerungen an diese Jugendzeit, die auch von einer Enttäuschung
nicht getrübt werden können. In einem Fall fuhr uns der Vater mit dem Auto zum
Waldschlösschen. Als unser „Tisch“ so richtig Fahrt aufgenommen hatte und in
Stimmung gekommen war, stand er schon vor der vereinbarten Zeit kurz nach
22.00 Uhr in der
Tür, um seine Tochter abzuholen und machte mir das freundliche, wenn auch
fragwürdige Angebot, ohne sie, also allein, noch länger zu bleiben. Aber mir
war die Stimmung vergangen, ich lehnte ab und ertrug in den nächsten Tagen den
verständlichen Spott der Klassenkameraden. Ich musste annehmen, dass ich
während der Vorstellung im Hause einen zweifelhaften Eindruck hinterlassen
hatte, wenn mir der besorgte Vater weder zutraute noch vertraute, seine Tochter
wie abgesprochen pünktlich und unbeschädigt wieder abzuliefern. Der besagte
„Tisch“ hatte an diesem Abend jedenfalls sein Thema und daran sein Vergnügen.
In einem anderen Fall erreichte
ich mit meiner Dame – jetzt schon nach Mitternacht – kaum noch das Ziel. Ihre
Schuhe drückten, zu eng, geschwollene Füße, blaue Flecken? Ich hatte keine
Tanzstunden besuchen können und war darauf angewiesen, dass meine Damen, die
ich immer gewarnt habe, meine „Fehltritte“ ertragen würden. Diese hakte sich
bei mir ein, aber es gab keinen Abschiedskuss, – der Handkuss war allerdings
schon verpönt – kein Wange an Wange oder gar noch mehr. Dennoch ging mir auf
dem Heimweg durch das nächtliche Schleswig durch den Kopf, ob wir nicht doch
die Grenzen der guten Sitten (der fünfziger Jahre) überschritten hätten. Wir
waren schließlich die Generation, der der Schweizer Sexualpsychologe Theodor
Bovet Vorträge über das Thema „Der Mann, das unbekannte Wesen“ hielt, in denen
er auf dezente Weise darauf hinwies, dass in der Jugend mehr auf Distanz als
auf Nähe zum weiblichen Geschlecht zu achten sei. Er beschrieb zwar schon das
„wie“, warnte aber vor dem „zu früh“, hatte volle Häuser und auch in Schleswig
ein überfülltes Stadttheater. Kein Wunder; denn sogar unsere Chorleiterin hatte
„nachhaltig“ empfohlen, ihn zu hören, obwohl weniger ihr Rat, sondern Bovets
unerwartet weit gehende Beschreibungen des „wie“ unter den Jugendlichen die
Runde gemacht hatten.
Wir waren, vermute ich, die
letzte Generation, in der nicht nur der Wortschatz „sex-frei“ war. Danach kam
Oswald Kolle, der den Begriff „Sex“ in der Alltagssprache hoffähig machte, aber
dabei blieb es nicht. Steht der Name Kolle für einen Epochen- oder
Paradigmenwechsel, für einen Fortschritt in Fragen der Sexualität? Die Antwort
steht (für mich) noch aus, wenn ich mich an unsere Jugend in den sog.
verstaubten fünfziger Jahren erinnere. Ich finde sie immer noch spannend und
schön, und der heute so oft hochmütig verspottete Staub der fünfziger Jahre hat
so manche Frühbestäubung mit beschwerlichen Folgen für das ganze Leben
verhindert.